
Die Schweizer Armee steht vor einer Herausforderung: Der Personalengpass gefährdet ihre Einsatzbereitschaft. In einer Zeit, in der sich Sicherheitslagen rasant verändern, ist es entscheidend, eine funktionsfähige und einsatzbereite Verteidigungsstruktur aufrechtzuerhalten.
Doch immer mehr junge Menschen entscheiden sich für den Zivildienst oder sind aus anderen Gründen vom Militärdienst befreit. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Truppen, sei es in der Cyberabwehr, im Katastrophenschutz oder bei der Sicherung der Landesgrenzen. Die Frage, wie dieser Lücke begegnet werden soll, gewinnt daher an politischem Gewicht und sorgt für hitzige Debatten. Ein Vorschlag sticht dabei besonders heraus. Doch was steckt hinter dieser Idee?
1. Warum Wehrpflicht allein nicht mehr reicht

Die allgemeine Wehrpflicht ist seit jeher ein Grundpfeiler der Schweizer Sicherheitspolitik. Doch sie verliert an Schlagkraft. Immer mehr junge Männer entscheiden sich für Alternativen, während demografische Veränderungen das System zusätzlich unter Druck setzen. Die Anforderungen an das moderne Militär haben sich gewandelt – von der reinen Landesverteidigung hin zu vielseitigen Aufgaben.
Die Armee braucht heute nicht nur körperlich fitte Rekruten, sondern auch technisch versierte Spezialisten. All das führt dazu, dass die Schweiz mit einem wachsenden Ressourcenproblem konfrontiert ist. Die traditionellen Wege reichen nicht mehr aus. Doch wer könnte diese Lücke künftig füllen?
2. Der wachsende Druck auf die Armeeführung

In internen Analysen und öffentlichen Stellungnahmen warnt die Armeeführung immer deutlicher: Wenn keine neuen Lösungen gefunden werden, fehlen bis Ende des Jahrzehnts über 30.000 Soldaten. Ein alarmierender Wert. Auch ehemalige Armeechefs schlagen Alarm. Die Gesellschaft müsse sich entscheiden:
Entweder man akzeptiere eine kleinere Armee – oder man finde neue Wege, um den Bestand zu sichern. In der Politik kursieren mittlerweile unterschiedlichste Vorschläge, wie die Zukunft der Armee gesichert werden soll. Nicht alle davon sind unumstritten. Ein Vorschlag jedoch sorgt besonders für Aufsehen.
3. Ausländer und Flüchtlinge in die Armee?

Der SVP-Nationalrat Erich Vontobel hat mit einem brisanten Vorschlag auf sich aufmerksam gemacht: Er will junge Ausländer und anerkannte Flüchtlinge in die Schweizer Armee integrieren. Sie sollen damit helfen, den drohenden Personalengpass zu entschärfen.
Viele von ihnen seien gut integriert, sprächen die Landessprachen und planten ohnehin, langfristig in der Schweiz zu bleiben. Warum also nicht auch einen Beitrag zur Verteidigung leisten? Der Vorstoß zielt dabei vor allem auf Menschen mit permanenter Aufenthaltsbewilligung ab. Doch was sagen Parteikollegen und Gegner zu dieser Idee?
4. Die Kritik aus den eigenen Reihen

Besonders innerhalb der eigenen SVP-Fraktion stößt Vontobel auf Widerstand. Politiker wie Mauro Tuena und Thomas Hurter befürchten, dass der Vorschlag zu einer Art Söldnerarmee führen könnte. Auch Zweifel an der Loyalität und an den Werten der potenziellen Soldaten werden laut.
Aus ihrer Sicht müsse die Schweizer Armee aus Personen bestehen, die fest in der Gesellschaft verankert sind und mit dem Land verwurzelt. Der Vorschlag spalte somit nicht nur das Parlament, sondern auch die eigene Partei. Aber was sagen Befürworter zu dieser Idee?
5. Argumente für die Integration

Vontobel hält dagegen: Wer dauerhaft in der Schweiz lebt, müsse auch Mitverantwortung für deren Sicherheit übernehmen. Gerade anerkannte Flüchtlinge und gut integrierte Ausländer könnten so Teil der Gemeinschaft werden. Der Dienst an der Nation sei ein Zeichen von Respekt und Dankbarkeit für das aufgenommene Land.
Zudem habe die Schweiz in der Vergangenheit mit Fremdpersonal in der Armee bereits Erfahrungen gemacht – etwa bei fremdsprachigen Söldnereinheiten in der Geschichte. Der Vorstoss sei keine Revolution, sondern ein weiterer Schritt der Integration. Welche rechtlichen Hürden stehen dem Vorschlag im Weg?
6. Eine Frage der Verfassung
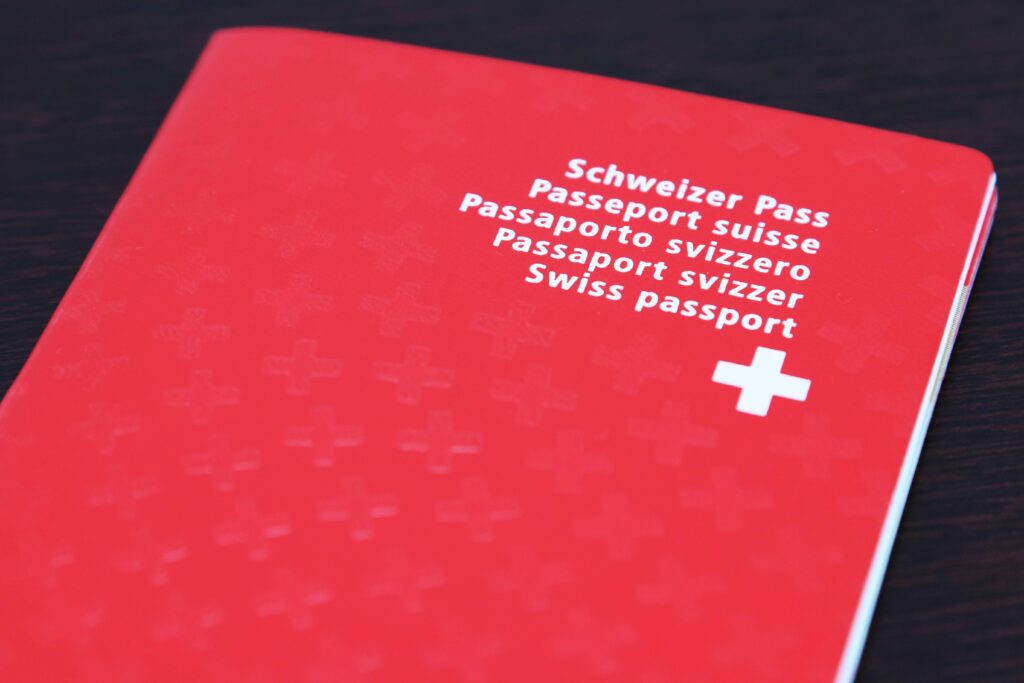
Damit der Vorschlag umgesetzt werden kann, müsste die Bundesverfassung geändert werden. Denn aktuell ist der Militärdienst nur für Schweizer Staatsangehörige vorgesehen. Eine Verfassungsänderung ist jedoch ein langer und steiniger Weg – besonders, wenn selbst die eigene Partei sich querstellt.
Zusätzlich müsste der Bundesrat prüfen, wie eine gesetzliche Verpflichtung junger Ausländer mit internationalen Verträgen vereinbar wäre. Rechtlich wie politisch steht das Vorhaben auf unsicherem Boden. Doch wie reagieren die Betroffenen selbst auf diese Debatte?
7. Wie denken Ausländer über den Vorschlag?

In sozialen Medien und ersten Interviews zeigen sich die Reaktionen vielfältig. Einige junge Ausländerinnen und Ausländer empfinden den Vorschlag als Chance zur Anerkennung und als Möglichkeit, ihren Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Besonders gut integrierte Personen mit familiären und beruflichen Perspektiven in der Schweiz sehen darin ein Zeichen des Vertrauens.
Andere lehnen die Idee strikt ab: Sie fürchten, zur Pflichterfüllung gezwungen zu werden, ohne dieselben Bürgerrechte zu genießen. Auch Menschenrechtsorganisationen mahnen, eine differenzierte Debatte zu führen, um Diskriminierung zu vermeiden. Die Diskussion über Zugehörigkeit, Sicherheit und Gleichstellung steht damit erst am Anfang – und könnte die Schweiz noch lange beschäftigen.
